Mai 2020 - Türrahmenportraits
Zwei Meter Abstand von meiner geöffneten Türe bis zum Schreibtisch an dem ich täglich mehrere Stunden verbringe. Zargen in seriösem Marineblau bilden einen würdigen Rahmen für Geschichten. Personen, die bisher nie stehengeblieben sind, erzählen wie sie ihren Alltag mit dem Virus erleben. Momentaufnahmen. Jeder geht anders damit um. Allen gemein ist die Hoffnung, dass sich in der Zukunft etwas verändert. Was genau, wissen sie oft nicht. Ich erfreue mich an diesen Gesprächen und Erzählungen. Ob sie nach der ersten Corona-Welle wiederkommen werden, weiss ich nicht.
Corona oder Covid
Ich haue in die Tastatur, beende den letzten Satz, bevor ich aufschaue und sie begrüsse. Sie lehnt mit dem Rücken im Türrahmen, adrett wie immer. Ich betrachte das schlaksige Profil ihres Körpers mit Genuss. Ist die kleine Wölbung eine Folge von zu häufigen Apéros in diesen Zeiten, überlege ich kurz. Sie bemerkt meinen Blick, der auf ihrer Körpermitte ruht und lächelt mich an. «Ja, ich bin schwanger. Behalte es bitte für dich, hier weiss es noch niemand.» «Ich freue mich für dich, 13. Woche?» frage ich sie. «14.» und fährt fort: «Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Das Virus hat uns die nötige Ruhe geschenkt. Wir überlegen uns, das Kind Corona oder Covid zu nennen.» Ihr Gesichtsausdruck zeigt mir, sie meint es ernst. «Wirst du das nicht eines Tages bereuen?» will ich wissen. «Ich glaube nicht, denn um sich entwickeln und wachsen zu können, braucht es stetige Veränderung und dafür steht das Virus.»
Betrogen
Erleichterung mischt sich mit Enttäuschung auf seinem Gesicht als er mir im Türrahmen erklärt, dass die Maturprüfungen ausfallen. Er hat sich gut vorbereitet. Corona raubt ihm die Möglichkeit sich zu beweisen, er fühlt sich um eine wichtige Erfahrung betrogen.
Hundstage
Am Rande der kleinen, kleinen Stadt liegt ein alter verwahrloster Garten. Zumindest auf den ersten Blick wirkt er so. Ein ausgebleichter runder Bungalow, dessen überdachte Veranda sich kreisförmig darum herum windet, gehört dazu. Er scheint auf der Plattform, auf der er errichtet wurde, zu schweben, da der Efeu jede Verbindung zum Boden verbirgt. Behütet von drei Linden, ist er von der Strasse her durch das Dickicht der Lebensbäume kaum zu erkennen. Neugierige Einwohner und davon gibt es sogar in dieser winzigen Stadt zu viele, können seit neuestem beobachten, wie die Arbeiter des einzigen Gartenbauunternehmens auf der anliegenden Parzelle dem Gestrüpp den Garaus machen.
Es ist Mirandas freier Tag. Nachdem die Arbeiter gegangen sind, nähert sie sich dem Zaun, der die Gärten trennt und mustert das Haus, das seit kurzem auf dem kleinen Grundstück trotzig in die Höhe ragt und mit seinem Schatten ihre Nachtkerzen bedroht. Ein Blick auf die Uhr bestätigt ihr, dass sie noch eine halbe Stunde Zeit hat bevor ihre Nachbarn zurück sind. Sie starrt auf die frisch gepflanzten Kirschlorbeeren, die kümmerlich in der Erde stecken und nach Wasser schreien. Über den Zaun hinweg, erreicht sie mühelos die kräftigste der Pflanzen und gräbt sie mit einem Stich aus. Sie vergrössert das Loch und wirft etwas hinein bevor sie den Setzling sorgfältig mit der übrig gebliebenen Erde umgibt.
«Mogli, Kismo, Bianca, Simi», säuselt es von nebenan. Miranda verzieht sich auf ihre Terrasse, hinter eine uralte Clematis, dort, wo ihr Schaukelstuhl steht. Drei der Viecher sind dem Rufen gefolgt, tauchen zwischen Mirandas Beeten auf, springen über den Zaun und reiben sich an den Beinen der Besitzerin. «Simi», komm zu Mami, geht es in einer etwas schrilleren Tonlage weiter. Ein Mann in Anzug und mit gelöster Krawatte, gut gepolstert um die Leibesmitte, taucht hinter ihr auf und umarmt ihre dürre Gestalt, die sich in Kostüm und bei diesen Temperaturen in einer Strumpfhose, die letzte Feuchtigkeit aus dem Leib schreit. «Papi» hat Hunger, sagt er und zieht sie ins Haus. «Simi taucht schon wieder auf, geh in die Küche»
Wie ein dickes Kissen schiebt sich die Hitze zwischen Miranda und Alltag. Sie dient als Entschuldigung für jedes Missgeschick und federt manche Unzulänglichkeit ab. Obwohl im August die Nächte wieder länger werden, steht Miranda um 5 Uhr auf, um in ihrem Garten zu werken. Die Morgenstunden, bevor sie das grobe jadegrüne Leinenkleid gegen die Uniform eintauscht und ihre mit Henna gefleckten Haare in einem Zopf versteckt, sind ihr kostbar. Ihre Beete sind in Bewegung. Die Umrisse von drei scharrenden Nachbarskatzen, die dort ihr Geschäft verrichten, zeichnen sich in der Morgendämmerung ab. Miranda findet den Weg zum Wasserhahn auch ohne Licht. Sie dreht voll auf und erfreut sich an hellgrauem Angora, das triefend über den Zaun flüchtet. Mirandas Lachen wird vom Strahl einer Taschenlampe weggespritzt. «Du Hexe, ich zeige dich an beim Tierschutzverein, meine Simi ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Zum Glück sind wir dich bald los und können endlich das Schwimmbad bauen lassen», keift die Nachbarin im Schein der Lampe. An ihrem Haaransatz haben sich Rinnsale aus Schweiss gebildet, die im bereits gepuderten Gesicht wütend ihre Furchen bis zum Kinn ziehen und auf die weisse Bluse tropfen.
Die Dämmerung hat dem Morgen Platz gemacht. Miranda packt Briefe in die Zustelltaschen ihres Anhängers und fährt los. Sie ist neben dem Poststellenhalter die einzige Angestellte, die nicht entlassen wurde und das auch nur, weil sie als Härtefall angesehen wird. Erst vor einem halben Jahr hat sie eine ihrer drei Stellen durch den unerwarteten Tod des Arbeitgebers verloren. Er hat Miranda wiederholt versprochen, sie mit einer Rente abzusichern. Ihre Tour ist anstrengend, sie schafft es fast nicht den Hügel hinauf, ohne vom Rad abzusteigen. Mit ihren 50 Jahren hätte sie eigentlich ein Anrecht auf ein Mofa, ihr Antrag jedoch, wurde ohne Begründung abgelehnt. Miranda tritt noch einmal kräftig in die Pedale, um vor «Krimskrams für Bares» kurz zu verschnaufen. Eine vertraute weisse Golden Retriever-Mischung, lacht sie durch eine fast blinde Fensterscheibe an. Sie bleibt stehen, obwohl die Sonne in diesem Sommer, in dem sich alle Tuyas braun verfärben, kein Mitleid mit ihrer Haut zeigt. Der Poststellenhalter auch nicht als sie eine halbe Stunde zu spät von ihrer Tour zurückkehrt. «Halten Sie sich bitte an die Arbeitszeitvorgaben, ich kann Ihnen die Überstunden nicht mehr vergüten.» ist sein Kommentar. Sie schweigt und schielt nach der Uhr. Endlich Feierabend.
Ob es noch da ist? Sie eilt in die Brockenstube. «Kann ich das Hundebild genauer ansehen?» fragt sie Egon, den Inhaber, unter der Tür. «Ich wollte gerade dichtmachen, kannst du nicht morgen wiederkommen?» «Bitte», fleht Miranda. «Du musst es aber selber holen. Er lässt sie vorbei und ins Schaufenster steigen. «Was willst denn du damit? Andauernd jammerst du über die Hunde, die nach deinen Hosenbeinen schnappen, sobald du die Briefe aus deiner Tasche nimmst». Miranda wundert sich ein wenig über das Gewicht als sie den Rahmen hochhebt. «Ich hatte mal genauso einen, Sirius war sein Name» lügt sie. Als sie aus ihrer Geldbörse drei Franken klauben will, winkt Egon ab. «Schon ok, ich bin froh, wenn ich es wieder los bin. Deine neue Nachbarin hat den gesamten Nachlass ihres Onkels bei mir abgeladen, nachdem er so plötzlich gestorben ist. Dafür, dass ich den antiken Schreibtisch, vollgestopft mit Altpapier, kaufen durfte», fährt er fort. «War er den Aufwand wert?» will Miranda wissen. «Ich glaube schon, aber bevor ich das Altpapier entsorgen und das Möbel genauer unter die Lupe nehmen konnte, hat sie ihn letzte Woche samt Inhalt zurückgekauft. Sie hat mir das Doppelte angeboten und ich habe natürlich zugegriffen» «Du hast dich doch jahrelang um Samuels Garten gekümmert, hat er nie was über den Sekretär erzählt?» Miranda verneint. Sie möchte nicht über Sämi sprechen, mit dem sie mehr als den Ertrag seiner Beete teilte. Zuhause löst Miranda neugierig das Bild aus dem schweren Rahmen. Der Hohlraum ist gefüllt mit Seidenpapier. Sie zieht es heraus. Darin eingewickelt sind Steine in verschiedenen Grössen, die wie unreine Bergkristalle aussehen. „Danke Sämi“, flüstert Miranda, nun habe ich sie gefunden, meine Altersversorgung. Miranda wickelt die Steine aus und verstaut sie in ihrem Kohlebügeleisen. Das Hundebild steckt sie mitsamt dem Rahmen, den sie mit Kiesel gefüllt, auf einem Pfahl befestigt hat, in ein frisch angelegtes Beet. Mogli oder ist es Kismo, sie kann die Viecher nicht auseinanderhalten, wetzt seine Krallen am Holz. Das Bild wackelt einmal kurz, kippt und der schwere Rahmen trifft den Kopf der Katze. «Da waren es nur noch zwei» murmelt Miranda und versorgt die Leiche im Kompostbehälter in Nachbars Garten. Gerade noch rechtzeitig kehrt sie in ihr Haus zurück bevor wie jeden Abend, Mogli, Kismo, Bianca, Simi ertönt. Miranda schielt zu Sämis Kompostbehälter in der Ecke, die von ihrem Garten aus so leicht zu erreichen ist und aus dem sie sich seit seinem Tod nicht mehr von der feinsten Erde, die es gibt, bedienen darf. Mogli und Bianca tauchen auf. Stur ruft „Mami“ weiter nach Simi und Kismo. Irgendwann gibt sie auf.
Miranda wird um drei Uhr von Katzengejammer geweckt. Sie hat bis um Mitternacht ihren Gefrierschrank, leergeräumt, auch er ein Hitzeopfer und wie Gestank und Farbe des aufgetauten Fleisches vermuten lassen, seit mehreren Tagen tot. Die Katze hüpft durchs offene Fenster aufs Bett und aus dem Schlafzimmer. Miranda schläft wieder ein, denn ihre Schicht an der Bar im Stadthotel, dem einzigen in dieser kleinen Stadt, beginnt erst am Abend. Am nächsten Morgen findet sie in der Küche aufgerissene Gammelfleischsäcke. «Bianca, du Luder», schimpft sie und macht sich auf die Suche nach ihr. Katzenhaare im Haus, da juckt die Haut nur schon in Gedanken. Im Wohnzimmer entdeckt sie etwas Lebloses in Schwarzweiss. Sie steckt das Fellbündel zusammen mit dem Fleisch in die Abfalltonne der Nachbarin. Während Miranda in der Erde grübelt, hört sie einen wütenden Aufschrei: «Mörderin» Miranda versteckt sich hinter der Clematis. Der letzte Überlebende kommt angekrochen und leckt Mirandas Hand. Angewidert packt sie Mogli im Genick und verdonnert ihn in ihrem Schopf zu Wasser und Trockenfutter. Dort kann er maunzen bis sie Zeit für ihn hat. Sie ist keine Mörderin.
Nachdem sie aus dem Stadthotel zurückgekehrt ist, setzt sich Miranda wie so oft in diesem unendlichen Sommer in ihren Schaukelstuhl. Hell leuchtet Sirius am Himmel. Ein Schnauben lässt sie aufschrecken. Sie späht hinter der Clematis hervor. Die Nachbarn sind damit beschäftigt Sämis Hund aus Mirandas Beet zu entführen. Am Tag danach, ein Samstag, schläft sie etwas länger. Als die Nachbarn fort sind, holt sie Mogli aus dem Schopf, bindet ihn in der Zustelltasche an und radelt zum Wald, wo sie ihn seinem Schicksal überlässt. Er tut ihr fast ein bisschen leid.
Zuhause hört sie die Nachbarin vergeblich nach den Katzen rufen. Die bösen Sticheleien der Frau erwidert Miranda mit festem Blick. Der Mann entfacht unterdessen eine verbotene Glut in der Feuerschale. Die Frau holt Fleisch und eine Flasche Wein. Lange vor den Hundstagen, als der Sommer noch milde gestimmt war, wuchs Mirandas Digitalis der Sonne entgegen und verbreitete seine giftige Blütenpracht im Garten. Die Frau öffnet den Wein und schenkt sich ein Glas ein. Sie muss die Flasche in einem funktionierenden Gefrierschrank gekühlt haben, denn das Glas beschlägt sich und es bilden sich kleine Tröpfchen, die sie mit der Zunge ableckt. Die Kapseln der Digitalis, inzwischen braun und dürr, sind am Aufbrechen. Dort wo Mogli und der Wald sind, donnert es. Der aufkommende Wind wirbelt die Samen zur Feuerschale der Nachbarn und würzt das Fleisch auf dem Rost, das dem perfekten Garpunkt entgegenbrutzelt. «Nein, ich bin keine Mörderin» sagt Miranda zu ihrem schlechten Gewissen und zu Mogli, der, auf der Flucht vor dem Gewitter, den Weg zurück aus dem Wald gefunden hat. Schnurrend umkreist er die beiden regungslosen Gestalten vor ihren leer gegessenen Tellern. Miranda greift zum Handy.
Susanne Lienert, August 2018
Das schwarze Schaf
Martha, deren Füsse den Feierabend herbei sehnen, schaut auf die Strasse. Es nieselt aus einer Wolkendecke, welche die Stadt seit einem Monat im Griff hält. Sie beschliesst, die Beleuchtung in den Weihnachtskrippen einzuschalten. „Ist es nicht etwas zu früh dafür?“ erkundigt sich die Studentin Elody, die eingestellt wurde, um die Adventszeit für die übrigen Angestellten, erträglicher zu gestalten. Flink verpackt sie für japanische Kunden eine Krippe samt Zubehör während sie sich fliessend auf Englisch mit ihnen unterhält. Eigenartig, wie begehrt unser Kunsthandwerk bei asiatischen Gästen ist, wundert sich Martha. „Mir fehlt das Licht“, seufzt sie. „Trotzdem bin ich froh, um diesen Verdienst, der meine Rente aufbessert. Da ich nur nachmittags arbeite, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich am Samstagnachmittag hier bin.“ Elody schluckt. An ihrem 20. Geburtstag hat sie begonnen, sich um ihre Altersvorsorge zu kümmern. Sie hat keinesfalls vor, so zu enden wie Martha oder ihre Eltern, deren klägliches Einkommen sie dazu zwingt nach der Pensionierung weiter zu arbeiten. „Schau, da ist es wieder,“ lenkt sie ab. Sie spähen zwischen den Krippenfiguren hindurch und nehmen das Gesicht ins Visier, das sich seit dem ersten Advent, immer im untersten Teil des Schaufensters, fest gegen die Scheibe drückt. Der Blick ist auf die Weihnachtslandschaft gerichtet und der Mund erzählt eine lautlose Geschichte dazu. Einheimische Künstler, jeder unverwechselbar, haben die Figuren geschnitzt. Die aufflackernde Beleuchtung haucht ihnen Leben ein. „Wie oft hast du, seit du hier arbeitest, die Abdrücke an nächsten Morgen wieder weg gewischt?“ fragt Martha die Studentin, die auch fürs Grobe zuständig ist. „Ich bringe es nicht übers Herz, rauszugehen und ihn zu verscheuchen. Er wird ja jeden Tag weggezogen, von wem, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.“ Elody spürt eine Hand auf ihrem Arm. „Ich möchte bitte dieses Schaf, das grösste im Schaufenster, aus der Nähe anschauen“, sagt eine Kundin auf Italienisch. Elody mischt sich zwischen die Hirten. Vorsichtig befreit sie die Hufe des Tieres vom Sägemehl, das den Wüstenboden darstellen soll. Aufgeschreckt von dumpfen Schlägen, dreht sie sich um. Abgeschabte, in einem attraktiven Norwegermuster gestrickte Fäustlinge, hämmern gegen das Glas. Braune Hände mit abgebrochenen Nägeln greifen nach mageren Schultern. Wie bei einer schlecht koordinierten Marionette schiessen die behandschuhten Fäuste gleichzeitig in die Höhe. Das staunende Gesicht weicht einer verzweifelten Fratze. Als Elody mit dem Schaf im Arm zurück in den Laden klettert, ertönt ein klagender Ton, der die dicken Scheiben durchdringt und alle Anwesenden erschaudern lässt. Die Italienerin fasst sich als Erste. Sie gibt Elody einen Schubs. „Geh raus und frag, was das Geheule soll,“ befiehlt ihr clownesk bemalter Mund. Elody reisst die Türe auf. „Kommt rein“, sagt sie zu dem Jungen und packt seine rechte Faust. Die Gestalt, die sich als junges Mädchen entpuppt, will ihn in die andere Richtung ziehen, doch er wehrt sich mit verzweifelten Fusstritten. Sie gibt auf und folgt ihm. „Erzähl“, verlangt die italienische Kundin. Trotzig wendet der Junge, der Malik heisst, seinen Blick ab stellt sich neben Elody und legt eine Hand schützend auf das Schaf. Zur Überraschung aller, antwortet stattdessen das Mädchen in verständlichem Italienisch. „Das Schaf, sieht aus wie sein Lieblingstier, das er mit der Flasche aufgezogen hat. Ich musste die gesamte Herde verkaufen, um für unsere Flucht zu bezahlen. Danach sprach er kein Wort mehr. Unsere Eltern sind im Bombenhagel umgekommen als mein Bruder und ich uns um die Schafe kümmerten. Über ein Jahr verbrachten wir in einem Auffanglager auf Sizilien. Seit wir dieses Geschäft mit Samir entdeckt haben, geht es ihm besser. Jeden Tag, wenn die Beleuchtung angedreht wird, muss ich hierher kommen,“ sagt Syria. „Ich arbeite beim Theater als Bühnenbildnerin und in der Requisite“, erwidert die Altstimme der Italienerin. Monatelang habe ich nach einem Schaf wie diesem gesucht und deutet dabei auf das Tier in Elodys Armen, dessen Augen Malik hilfesuchend anzuglotzen scheinen. Es hat die perfekte Grösse, der Preis wie auch die Farbe stimmen und ich will keinesfalls darauf verzichten.“ Martha, die sich von Elody das Gesprochene hat übersetzen lassen, verschwindet sichtlich bewegt in den Privaträumen, wo sie sich suchend umschaut. Die letzte Lieferung des Schnitzers, der das schwarze Schaf erschaffen hat, ist noch nicht eingetroffen, obwohl er am Tag zuvor versprochen hat, die Ware per Kurier zu senden. Sie greift zum Telefon, um Johannes anzurufen. Gähnend meldet er sich. Martha erstickt seine Ausreden im Keim. „Ich benötige dringend das zweite schwarze Schaf, das wir letzte Woche zurückgeschickt haben.“ „Sei froh, dass ich am Weihnachtsapéro des Schnitzervereins tüchtig gebechert habe“, meint er lachend. Ich wollte dem Vieh noch heute Morgen ein Bad in einer weissen Farbe verpassen und es deinem Chef in der nächsten Sendung nochmals unterjubeln. Es wäre zwar jammerschade gewesen, um das kostbare Ebenholz, aber ich brauche das Geld.“ „Könnte ich Samir trotzdem in Raten abstottern, ich möchte ihn jemandem schenken, der ihn dringend braucht“, fällt ihm Martha ins Wort. Aus dem Verkaufsraum dringt wieder lautes Geplärre als Syria ihrem Bruder erklärt, dass er Samir nicht wiedersehen wird. Johannes horcht auf und lässt sich von Martha Maliks Geschichte erzählen „ Ich werde sofort losfahren und das Schaf persönlich vorbeibringen.“ Martha kehrt in den Laden zurück und bittet Elody zu übersetzen, dass sie einen Ausweg gefunden hat. Zögernd geht die Italienerin auf den Vorschlag ein, die Wartezeit mit Kaffeetrinken zu verkürzen, denn sie will Malik das Schaf nicht überlassen bevor der Ersatz eintrifft. Syria unterhält sich in gebrochenem Deutsch mit Martha zu der sie sofort Vertrauen gefasst hat, während sich die Kundin und Malik misstrauisch beäugen bis Johannes eintrifft. Die Italienerin begutachtet das mitgebrachte Tier und lobt die noch kunstvollere Ausführung. Mit sichtbarer Erleichterung drückt Elody dem Jungen Samir in die Arme, dem die Tränen über das Gesicht laufen.
Susanne Lienert, Dezember 2016
Zerkratzte Stille
Müllschluckerin sollte in ihrer Jobbeschreibung stehen. Wie bei einer Stopfgans das Rohr, steckt unverrückbar die Trauer in ihren Innereien fest. Statt Maisbrei und Schweineschmalz, die über einen Trichter in die Mägen der Gänse gepumpt werden, wird sie mit Aufgaben gemästet, die niemand sonst übernehmen will. Mit jedem Tag wird ihre Stimme leiser, zu sehr schmerzt der Druck, der sich in ihrem Hals ausbreitet. Ablehnen kann sie die ungeliebten Arbeiten ebenso wenig, wie die Gans, in einem zu engen Käfig, mit den Flügeln um sich schlagen. Der Schlachttag wird für die Gänse nach der wochenlangen Qual zur Erlösung. Sie haben es hinter sich, im Gegensatz zur Müllschluckerin, die lächelnd in ihrem Broterwerb ausharren muss, während ihr Herz in nicht geweinten Tränen ertrinkt. Mit einem Schmunzeln hat sie vor einiger Zeit beobachtet wie die junge Kollegin sich lautstark für den Bereich begeistert, den die Müllschluckerin über Jahre, in enger Zusammenarbeit mit ihrem Vorgesetzten, aufgebaut hat. Nie hätte sie gedacht, dass sie innert Monatsfrist in langweiliger Routine ersticken und ihr Platz in allen wertschöpfenden Bereichen plötzlich mit IHR besetzt sein würde. Ein rhythmisches Klackern gibt der wohltuenden Stille, die während der Mittagspause das Gebäude beherrscht, den Laufpass, nähert sich und verstummt vor dem Schreibtisch der Müllschluckerin, deren glasiger Blick am Bildschirm klebt. Einschmeichelnde Worte erklingen: „Ich habe nachgefragt, ob ich das an dich weitergeben darf. Die Geschäftsleitung - damit meint sie ausschliesslich den Chef der Müllschluckerin, allen anderen ist es egal, wer die unbeliebtesten Arbeiten in der Firma übernimmt, war einverstanden, weil sich unsere Aufgabengebiete überschneiden und ich so unter Termindruck stehe.“ Ein Bündel mit Listen gleitet lautlos in ihre eisige Hand. Die Müllschluckerin drückt dabei die Zungenspitze an ihren Gaumen, um mit den boshaften Gedanken, die sich in ihrem Kopf zu messerscharfen Worten formen, nicht die Stille zu zerkratzen. Gepaart mit leuchtenden Augen und einem triumphierenden Lächeln, setzen die mageren Stelzen der anderen, selbstbewusst klappernd, den Siegeszug zum Chefbüro fort. Still schliesst sich die Türe hinter ihr.
Susanne Lienert, Januar 2016

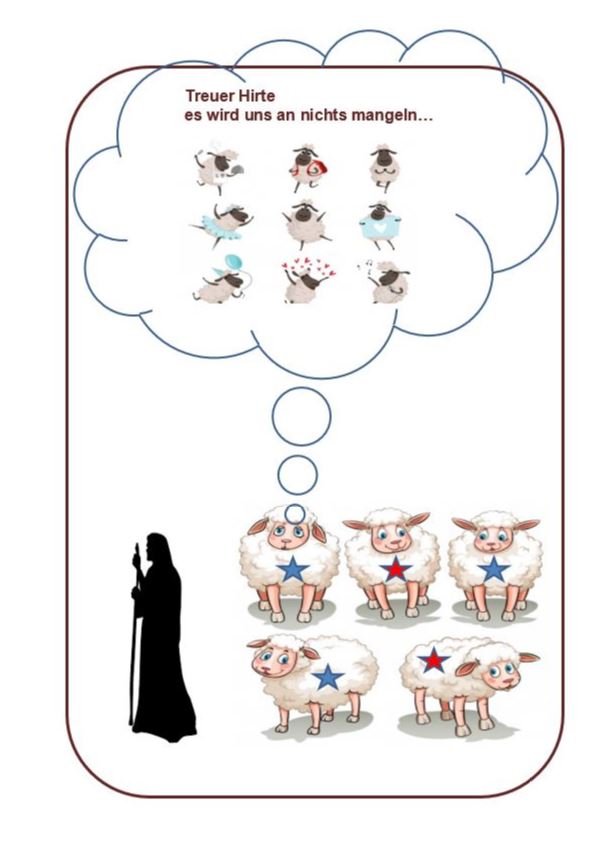
Neueste Kommentare
Was bleibt in der Adventszeit, sind die Lichter, die etwas Wärme und Geborgenheit verströmen und allmählich die trüben Nebel des Novembers vertreiben. Wenn man gut hinschaut. :)
Sich einzugestehen gelangweilt zu sein, ist ein erster Schritt. Wenn es nicht möglich ist, den Broterwerb einzutauschen gegen mehr Sinnhaftigkeit, kann das Freizeitverhalten angepasst werden.
Boreout:
Doch es ist gut zu wissen, dass sich nicht nur bei mir solche Symptome bemerkbar machen, wenn auch (noch) nicht im ganzen Ausmass wie von dir beschrieben
Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich deinen Gedanken folge. Sie sind manchmal ganz klar und tiefgründig, manchmal verschlungen und im ersten Moment scheinbar nicht nachvollziehbar.